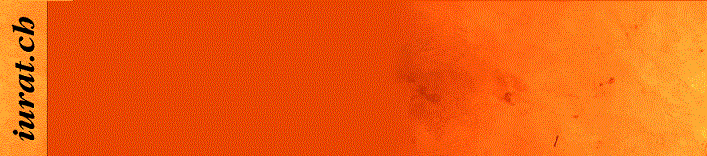
| Home | Portrait | Familie | Lebenslauf | Kontakt |
Konrad Ilg und Hedwig Ilg-Otter waren vermutlich kein erfülltes Paar. Sie heirateten wohl deshalb, weil Hedwig schwanger wurde. Ich kannte noch meine Grossmutter und meinen Grossvater gut. Sie – geboren 1880 -, die Tochter eines Schneidermeisters aus und von Freiburg, habe ich in Erinnerung als humorvolle, intelligente Frau, die belesen und musikalisch gebildet war, sehr interessiert an Theater, Konzert und Oper. Sie besass eine schöne Bibliothek mit vielen und sorgfältig ausgestatteten Ausgaben der Bücherei Guttenberg, von der ich noch einige Exemplare besitze. Sehr beeindruckte mich ihre Diskothek, damals noch bestehend aus Schelllackplatten mit 78 Touren, die sie auf einem Phonographen – ein hohes, schlankes Möbel mit eingebautem Schalltrichter – abspielte, nachdem man ihn mit einer grossen Kurbel aufgezogen hatte. Sie konnte es nicht sonderlich gut mit uns Kindern, meiner Schwester und mir. Sie hatte immer Angst, wir würden etwas in der Wohnung kaputt machen. So hatte ich auch keinen sonderlich persönlichen Zugang zu ihr. Am zugänglichsten war sie beim Essen. Meine Mutter verwöhnte sie immer mit Desserts, die sie über alles liebte. Als Freiburgerin war sie perfekt zweisprachig. Ich hatte immer den Eindruck, dass sie unter ihrer Lebenssituation litt und eigentlich eine deprimierte und einsame Frau war. Sie hatte sich offenbar einen Mann gewünscht, der zuhause gewesen wäre. Mein Grossvater indessen war überall – ausser zuhause.
Konrad, mein Grossvater, geboren 25.1.1877 Ermatingen, gestorben 12.8.1954 Bern, von Salenstein, Sohn des Jakob, Handwerkers, und der Katharina, Wäscherin und Putzfrau, war mit seiner Schwester Frida ein illegitimes Kind des Jakobs. Darüber wurde in der Verwandtschaft eisern geschwiegen. Wie bereits kurz gestreift, heiratete seine Mutter Katherina einen «Gilg», der bereits zehn Kinder hatte. Konrad wurde zu Pflegeeltern in Salenstein gegeben, dann als Dienstbote zu Kleinbauern. Er hatte es offenbar nicht allzu schlecht dort.
Seine Schwester Frida verzieh ihrer Mutter nie, sie weg gegeben zu haben. Sehr jung emigrierte sie nach England als Gouvernante und lernte dort den vermögenden und erfolgreichen Porzellanhändler Harry Pank kennen, mit dem sie sich verheiratete. Als Kleinkind erlebte ich noch meine Grosstante Frida bei einem Besuch in England, an die ich mich vage erinnere, vor allem an einen schönen Garten und einen sehr weichen Busen. Sehr gut mag ich mich an den jüngeren Bruder von Harry Pank erinnern, den Goerge – Jahrgang 1865, passionierter Gärtner und Seerosenzüchter -, den ich zusammen mit meinem Vater mit ungefähr 11 Jahren besuchte. England erlebte ich als lebendiges Museum mit den alten Autos, den Dampflokomotiven, den Schilfdächern, den Windowbows, den Scharen von frack- und zylinderbewehrten Bankangestellten, die des morgens in London einströmten. Der Eindruck wurde noch verstärkt durch George Pank’s Erzählungen, der als erfolgreicher Porzellanverkäufer die High Society kannte, weil er ihnen Porzellan andrehte, so Königin Viktoria, Kaiserin Eugénie, Churchill etc.
Konrad besuchte die Primarschule in Salenstein, just jene, die Napoleon III. im Schweizer Exil der Gemeinde Salenstein gestiftet hatte. Konrad war dem Pfarrer von Ermatingen aufgefallen, der ihn förderte und dafür sorgte, dass er eine Schlosserlehre von 1894-97 in Frauenfeld absolvieren konnte. Anschliessend besuchte er die Kunstschlosserschule in Zürich, ab 1897 ging er auf die Walz. 1898 setzte seine gewerkschaftliche Tätigkeit im Schlosserfachverein Zürich ein. Von 1903 bis 1909 war er in Lausanne. Dort lernte er auch Französisch. Er lernte die Sprache spontan in der alltäglichen Redepraxis, was er mit einem Lehrbuch vertiefte. Damals wohnte er in einer schlecht geheizten Mansarde. Wenn es im Winter des Morgens zu kalt wurde, stand er auf und büffelte Französisch. Wie ich mich erinnere, sprach er ein sehr korrektes Französisch, aber mit einem deutlichen schweizerdeutschen Akzent. Von 1905 an präsidierte er den Lausanner Schlosserfachvereins und 1908 und 1909 den Arbeiterbund und initiierte die Fusion der lokalen Fachvereine, dann wurde er Sektionspräsident der Lausanner Metallarbeiter. 1908 führte er den Bauarbeiterstreik. 1909 wurde er zum Zentralsekretären des Schweiz. Metallarbeiterverbandes nach Bern berufen und leitete 1915 die Fusion des Schweizerischen Metall- und des Uhrenarbeiterverbandes zum SMUV (Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeiterverband) ein. 1915 wurde er dessen Zentralsekretär für die franz. Schweiz. Von 1917 bis zu seinem Todesjahr 1954 leitete er als Zentralpräsident den Verband. 1919 war er Mitglied der Schweizer Delegation an der ersten Internationalen Arbeitskonferenz in Washington, dessen Vorstandsmitglied er von 1927 bis 1937 war. 1937 wurde er zum Vizepräsidenten des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes gewählt, was er bis 1941 blieb. Sekretär des internationalen Metallarbeiterbundes war er von 1921 bis 1954. Er kam aus der Bewegung der Grütlianer. Sein Übertritt zur SPS erfolgte kurz nach 1900. Er vertrat die Partei von 1910 bis 1939 im Stadtrat von Bern, von 1918 bis 1946 im Grossen Rat, von 1918 bis 1919 und von 1922 bis 1947 im Nationalrat. Während des Landesstreiks von 1918 war er Vizepräsident des Oltener Aktionskomitees. 1919 wurde er als Mitglied der Geschäftsleitung der SPS gewählt, 1928 bis 1936 amtete er als Vizepräsident. Eine erstaunliche Karriere für einen illegitimen Verdingbuben.
Konrad Ilg galt als markanter Kopf der Arbeiterbewegung des 20. Jahrhunderts. Meine Mutter berichtete mir von seiner Belesenheit in den Sozialistischen Theoretikern, vor allem in den französischen Frühsozialisten Pierre Joseph Proudhon, Charles Fourier und Jean Jaurès, die in einer Tradition des humanitären Sozialismus standen und ihn sehr prägten. Seine ersten Kontakte mit diesen Autoren hatte er offenbar sehr früh. Die Verdingbuben mussten beim Brennen des Schnapses des Nachts neben dem Brenngeschirr wachen. Das musste er auch. Zufälligerweise lag im Brennraum ein Stapel Bücher, den er zu entdecken begann und der vor allem sozialistische Literatur aus Frankreich in deutscher Übersetzung enthielt. Gierig las er und war fasziniert. Ganz in dieser Tradition hielt er Streiks für ein Mittel zur schrittweisen Durchsetzung von Reformen, die sich nur ausnahmsweise aufdrängten, nämlich dann, wenn der sonstige demokratische Prozess blockiert war. Dieser Anschauung gemäss setzte er sich im SMUV radikal und autoritär gegen die Vertreter der extremen Linken durch.
Hans-Peter Tschudi (Bundesrat, 1913 bis 2002) erzählte mir, dass er als Student eine Veranstaltung des SMUV besuchte, weil er meinen Grossvater hören wollte, der einen Vortrag halten sollte. Konrad Ilg kam und wurde vom lokalen Sekretären begrüsst, der ihm auch das Wort erteilte. Bevor er zum Vortrag schritt, erhob er sich, schaute in den Saal, visierte mit ausgetrecktem Arm und Zeigefinger einige Mitglieder an, die er reihum mit Namen benannte, aus dem SMUV kurzerhand ausschloss und aus dem Saal weisen liess. Es waren Vertreter der extremen Linken. Hans-Peter Tschudi war auch deshalb beeindruckt, weil niemand aufbegehrte. Die Autorität von Konrad Ilg war unangefochten. Der Vortrag sei dann sehr eindrücklich gewesen, weil mit hohem Engagement und prägender Nachhaltigkeit vorgetragen, erinnerte sich Hans-Peter Tschudi.
Konrad Ilg galt als pragmatischer Politiker, der bereits 1919 die Einführung der 48-Stundenwoche in Teilverträgen mit dem Arbeitgeberverband in der Metall- und Maschinenindustrie errang. Er förderte Teilvereinbarungen, die letztlich und in einer Zeit besonderer innerer und äusserer Bedrohung im sogenannten Friedensabkommen des Jahres 1937 ausmündeten und erstmals eine dauerhafte Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen dem Arbeitgeberverband schweiz. Maschinen- und Metallindustrieller und dem SMUV schuf. Beide Parteien wurden zur Konfliktbeilegung auf dem Verhandlungsweg verpflichtet. Initiator der Vereinbarung war Konrad Ilg gewesen, der im Arbeitgeberpräsidenten Ernst Dübi einen interessierten Partner fand. Beide setzten sich schliesslich gegen interne Widerstände durch, was dem Arbeitsfrieden zum Durchbruch verhalf.
Konrad Ilg war auch in der internationalen Gewerkschaftsbewegung eine profilierte Persönlichkeit, welche sich nach dem 2. Weltkrieg dafür einsetzte, dass die deutschen Gewerkschaften wieder international eingebunden wurden. Auch für die Aufnahme der amerikanischen Verbände in den Internationalen Metallarbeiterbund war er verantwortlich.
«Die politische Tätigkeit Ilgs trug ebenso den Stempel des Realismus. Mit seinem Eintreten für sozialpolitische Anliegen der Arbeiterschaft, vor allem für die Arbeitslosenversicherung, als Mitglied der überparteilichen Richtlinienbewegung und der Eidgenössischen Preiskontrollkommission genoss er auch in bürgerlichen Kreisen Anerkennung. Die Fronten bekämpfte Ilg, der von 1933 an zu den Förderern der Wochenzeitung "Die Nation" gehörte, entschieden. 1942 wurde ihm der Titel Dr. h.c. der Universität Bern, verliehen.» (http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D4539.php)
Meinen Grossvater erlebte ich als einen «Grand-papa gâteau», der meiner Schwester und mir jeden Wunsch von den Augen ablas und nach Noten verwöhnte. Zu ihm hatten wir beide ein sehr persönliches und gutes Verhältnis. Er war ebenso gütig wie autoritär. Als wir einmal nach Vitznau fuhren, ins Grand-Hotel des SMUV, Floralpina, gebot er meinem Vater, der den präsidialen Wagen des SMUV steuerte – ein «Citroën traction avant, large» -, beim Hafen in Luzern zu stoppen und verkündete knapp, er fahre mit mir auf dem Dampfschiff nach Vitznau. Wir bummelten langsam dem Schiff zu und winkten dem Wagen mit der Familie nach und ich staunte nicht schlecht, dass plötzlich vor uns auf der Passerelle zum Schiff der Kapitän und der erste Offizier standen und meinen Grossvater mit der Hand an der Mütze salutierten, die er mit Handschlag und Vornamen begrüsste. Ein Matrose lenkte das übrige Publikum uns aus dem Weg, aus welchem wiederum mein Grossvater respektvoll mit « Sälü Chueli» oder «Grüss Gott Herr Doktor oder Nationalrat» begrüsst wurde. Dem Publikum lenkenden Matrosen gab mein Grossvater auch die Hand und machte einen Witz, den ich nicht verstand, aber die Leute lachten, und der Matrose liess sie dann frei durch.
(Zitat aus dem historischen Lexikon der Schweiz zu «Konrad Ilg». Dem Artikel sind auch die Übrigen hier vorgetragenen Fakten entnommen. (http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D4539.php)
Im Schiff geleitete uns dann der Offizier über eine Metalltreppe in den Maschinenraum, wo wir die Fahrt bis Vitznau verbrachten und mein Grossvater zusammen mit den Heizern und Mechanikern mir die Funktion der Maschinen erklärte. Ich war sehr beeindruckt und bin noch heute von Dampfmaschinen fasziniert.
Sehr prägend für mich war eine Fahrt in die Heimat meines Grossvaters, nach Salenstein am Untersee, wo er meinem Vater auf der Höhe des Arenenbergs gebot, den Wagen anzuhalten und erklärte, er gehe mit mir in den Arenenberg. Als wir beim Eingang des Museums läuteten, öffnete ein bereits älterer kleiner Mann, mit einer runden drahtgefassten Brille und einem Beret. Es war Jakob Hugentobler, der Archivar des Museums. Mein Grossvater und er begrüssten sich mit Vornamen und wir traten ein. Er wollte eben das Museum schliessen, denn es war knapp 17 Uhr. Das unterliess er aber und führte uns durch das Schloss. Ich war von den grossen Bildern, den schönen Räumen und der Ambiance dieses Hauses sehr beeindruckt, ebenso durch die Persönlichkeit von Jakob Hugentobler, der so anschaulich die Bewohner des Arenenbergs wieder zum Leben erweckte. Von diesem Besuch datiert mein Interesse für Napoleon III, das ich mit meinem Grossvater teilte, der vor allem die Sozial- und Arbeiterschutzgesetzgebung mit der Koalitionsfreiheit Napoleons III. - die damals fortschrittlichste der Welt – sehr interessierte. Er zeigte mir auch den Ort der Tropfsteingrotte unterhalb des Arenenbergs - damals noch verschüttet, heute wieder sichtbar - , wo der Legende nach bei Vollmond Napoleon III auf dem Pferde erscheine und alle Fragen beantworte. Als Junge habe er sich bei Vollmond einmal hingewagt und sei bitter enttäuscht gewesen, dass Napoleon III. nicht erschien!
Mein Grossvater mütterlicherseits, Auguste Blanc, war ein Sohn bürgerlicher Eltern, eines grosszügigen Grossbauern - Charles - und einer autoritären Geschäftsfrau - Lucie geb. Ecoffey -, die einen Laden in Bulle führte.
Ich habe ihn als introvertierten Menschen in Erinnerung. Er war Linkshänder, was ich auch bin. Als Kind band man ihm den linken Arm in einen Sack, den man hinter seiner Bank fixierte, so dass er gezwungen war, rechts zu schreiben. Das scheint ihn tief getroffen zu haben und prägte ihn fürs Leben.
Er führte vorerst den elterlichen Hof «La Tula» in Bulle, übernahm dann dort die Gastwirtschaft «Des Arts et Métiers». Durch Bürgschaften ruinierte er sich. Seine letzte berufliche Station war die Leitung des Schlachthofes von Bulle.
Er stammte aus einer alteingesessenen Familie, sehr politisch engagiert bei den Radikalen. Einer seiner Vorfahren hatte den Vogt von Corbières ermordet und floh deshalb mit seiner Familie nach Amerika. Meine Mutter hatte mit diesem Teil der Familie noch Kontakt.
Meine Grossmutter mütterlicherseits war eine ebenso liebevolle wie autoritärer Frau, eine geborene Castella, deren Vorfahren adelige Ministerialbeamte des Grafen von Greyerz warten. Sie hatte Stil. Als noch junge Frau war sie als Erzieherin bei einer adligen Familie in Ungarn und sie sprach gerne und noch im Alter ungarisch, sang mir auch ungarische Lieder vor – zu meiner grossen Belustigung als Kind. Bei einem Haar hätte sie in Ungarn sich mit einem k. und k.-Offizier verheiratet. Da wurde aber Ihre Mutter krank und sie reiste heim, um diese zu pflegen, traf dann Auguste Blanc, den sie heiratete und dem sie zehn Kinder gebar.
Mein Vater war Einzelkind, von seiner Mutter sehr verwöhnt. Das prägte ihn, ebenso wie auch die Abwesenheit des Vaters. Er wuchs in Bern auf, zuerst am Holizkofenweg, dann in der Eisenbahnersiedlung an der Schwarzenburgstrasse, wo seine Eltern ein genossenschaftliches Haus mieteten. Mein Vater war sportlich und scheute die Auseinandersetzung nicht. So erzählte er mir, dass er für seine Mutter im damals noch ländlichen Köniz zusammen mit einem Schulkollegen mit dem Leiterwagen Äpfel bei einem Bauern holen musste. Die Buben der Eisenbahnersiedlung und von Köniz standen im Streit. Mein Vater und sein Kollege wurden angegriffen und sie wehrten sich, indem sie die Könizer mit Äpfeln bewarfen. Als sie heimkamen, war der Leiterwagen leer, die Äpfel sämtliche verschossen.
Als im Jahr 1918 der Generalstreik ausbrach, in dessen Aktionskomitee mein Grossvater bestimmend mitwirkte, stiegen auch die Spannungen unter den Schülern, was die politischen Fronten unter den Eltern spiegelte. Die Grosseltern schickten meinen Vater kurzerhand nach la Chaux-de-Fonds - sozialdemokratisch und gewerkschaftlich dominiert und damit weniger aufgewühlt in der politischen Atmosphäre -, wo er beim Sekretären des SMUV, Ernest Montandon (1876-1963) und seiner Frau, wohnte. Ich erinnere mich noch gut an «Grand-Maman Montandon». Dort verbrachte er offensichtlich - wie man seinen Schilderungen entnahm - eine sehr gute Zeit, machte dort auch das Gymnasium. So war er ein perfekter Bilingue in Wort und Schrift, überhaupt sprachbegabt, beherrschte er doch englisch – eine Folge seiner häufigen Aufenthalte bei seiner Tante Frida in England – italienisch und spanisch. Spanisch lernte er in den frühen 30er Jahren, als er als Sekretär eines Arztes arbeitete, der in Spanien Überlebensexperimente machte. Er erprobte die Überlebenschancen von Schiffsbrüchigen im Meer. Mein Vater hatte sein Tagebuch zu führen.
Nach verschiedenen Wirtschaftspraktikas trat während der Wirtschaftskrise mein Vater in den Dienst der Stadt Bern, zuerst als Quartieraufseher, dann als Chef der städtischen Fremdenpolizei.
Mein Vater, äusserlich ein eleganter und gewinnender Mann mit unerschöpflichem Humor war als Charakter sehr strickt, etwas egoistisch, sehr belesen, von analytischer Brillanz und hoher Disziplin, was er im Sport bis zum Exzess trieb. Ihm danke ich die Arbeitsdisziplin, das vernetzte Denken und die Verachtung des Sportes, den er mir gründlich verleidete. Es musste immer ein Gemurkse sein!
Mein Vater bemühte sich sehr, ein guter Vater zu sein. Er wollte nicht so sein wie sein Vater, der nie präsent war. Ihm war wichtig, mit seiner Familie zu leben. Er kümmerte sich um meine Schwester und mich. Schade bloss, dass er ein misogyner Charakter war und fand, für meine Schwester eigne das Gymnasium nicht, die werde noch heiraten, während für mich keine Ausbildungskosten zu gering waren.
Meine Mutter war eine sehr liebevolle, umsorgende Frau, mit sehr markantem Charakter und hoher künstlerischer Begabung, interessiert an allen Künsten, handwerklich sehr begabt, deshalb auch eine gesuchte Modistin. Sehr gepflegt, immer elegant und mit Stil, war sie eine berückende Erscheinung, eine vorzügliche Gastgeberin und wunderbare Köchin, welche die französische Kochkunst bei ihrer Mutter erlernt hatte - von ihr habe ich die Liebe zur guten Küche. Ihre Einladungen waren begehrt, da kulinarisch hochstehend. Sie wusste auch Gäste zu empfangen und verstand die Kunst der Konversation, da diplomatisch sehr begabt, was sie nicht hinderte, in ihren politischen Ansichten höchst radikal zu sein – ein Erbe ihrer Familie - und mitunter auch sehr klare Voten deponierte. Ich mag mich an die vielen Tischgespräche zuhause erinnern, wo viel politisiert wurde. Mein Vater - Sozialdemokrat wie sein Vater und gewerkschaftlich engagiert – war regelmässig weniger links als meine Mutter, deren radikaler Impuls noch in einem politisch dunkelschwarzen Gebiet geschärft worden und mit einem antiklerikalen Impetus – trotz katholischem Glauben – aufgeladen war. Das waren spannende Diskussionen. Krude, aber mit Stil waren gewisse ihrer Äusserungen. So mag ich mich an diese Szene erinnern, wo sie mit etwas über neunzig an meinem Arm den Speisesaal ihrer Altersresidenz verliess, zusammen mit einer Gruppe von Damen, als die eine unerwartet und wohl auch ungewollt einen geräuschvollen Magenwind entfahren liess. Alle Damen kicherten, nur eine begann zu schimpfen und hielt das für unstatthaft. Meine Mutter blieb stehen, reckte sich auf, sah die verärgerte Dame würdevoll an und meinte mit fixer, aber keineswegs unfreundlicher Stimme: «Madame, tout cul pette, même le votre», sagte es und wandte sich wieder den anderen Damen und mir zu.
Sie wuchs in Bulle auf, just zu der Zeit, als ihre Familie wirtschaftlich abstieg, was sie hinderte, das örtliche Mädchenpensionat für Töchter aus besseren Kreisen zu besuchen. Sie machte deshalb eine Lehre bei Mademoiselle Becholet, einer Modistin in Bulle, als Hutmacherin. Nach der Lehre arbeitete sie in einem Hutmachergeschäft in Thun, dann in Bern, wo sie meinen Vater kennen lernte und eröffnete in Freiburg ein eigenes Geschäft. Ihre Geschäftsbuchhaltung habe ich noch.
Nach der Heirat verkaufte sie das Geschäft, empfing aber immer noch Kundinnen, um ihnen Hüte anzufertigen. Ich erinnere mich, wie sie den Frauen die Hüte anprobierte, manchmal hoch moderne, formal streng gehaltene, dann wieder ausladende mit Blumen- und Federschmuck. Wenn sie an den Hüten arbeitete, sass ich neben dem Arbeitstisch am Boden und spielte mit den unzähligen Knöpfen, die in Schachteln wohl erwahrt waren.
Meine Schwester Beatrice Cécile Ilg (1950 bis 2013)
Ich hatte ein inniges Verhältnis zu meiner Schwester, sie war mir eine vorzügliche Lebensbegleiterin und kluge Ratgeberin. Leider verstarb sie viel zu früh an einem Pankreaskrebs am 2. Januar 2013. Sie fehlt mir.
Ich beschreibe sie mit der Todesanzeige und den Abschiedsworten an ihrer Abdankung.
Meine Worte, vorgetragen von Yann Pugin:
Quelques mots maintenant au sujet de Beatrice de la part de son frère Walo:
Quand Beatrice naquit le 24 octobre 1950, j’avais trois ans et demi.
J'attendais impatiemment de voir ce que c'etait que cette « petite soeur» qui répondait au nom de Beatrice. A peine était-elle arrivée a la maison, et je n'avais même pas pu la voir encore, puisque mes parents étaient en pleines embrassades avec ma grand-mère et moi, et déjà, le petit paquet que maman tenait se mit à brailler et devint bleu d'impatience. Ce petit « pruneau », c'est ainsi qu'on me l'expliqua, avait faim. Ma grand-mère avait déjà préparé un biberon qui calma le « pruneau », qui d'ailleurs vida le biberon d'une gorgée, pour le renvoyer immédiatement en pleine figure de ma mère! Ma grand-mère dit « oh ! » et trouva cela très mignon, et moi très étonnant.
Le petit « pruneau » grandit rapidement et devint plus civilise dans ses mœurs de table ...
Je me rappelle bien d'une scène particulaire, dont il existe d'ailleurs une photo : Beatrice était dans son berceau, moi appuyé sur le bord de la corbeille avec une de mes mains, tandis que mon autre main jouait avec sa petite menotte. Elle riait avec une sorte de gargouillement qui m'amusait beaucoup et elle me regardait fixement avec ses yeux bruns.
Nous habitions alors vis-vis d’une petite forêt avec un pâturage, où des moutons broutaient. Ce terrain était séparé de notre maison par une route très fréquentée. A la grande terreur de ma mère, un jour où elle nous cherchait vainement dans le jardin, très anxieuse, elle nous vit dans ce pâturage. Arrivant au milieu des moutons, elle me trouva avec Beatrice dans sa poussette, lui donnant une première leçon de Zoologie ! Ma mère me demanda vivement ce que je faisais ici « pour l'amour de Dieu ». Je lui répondis très gentiment et avec la pondération qui s'imposait : « J'aime bien m'occuper de Beatrice et il faut lui montrer quelque chose, car sinon elle s'ennuie dans sa poussette ».
Enfants, nous eûmes bien sur nos luttes et nos désaccords, mais nous nous entendions finalement toujours bien et je tâchai d’être pour elle - à n'en point douter, ce fut mon rôle inné - son chevalier protecteur.
Mon père, homme plein d'esprit et d'humour, mais profondément misogyne, était de I' avis que Beatrice devait apprendre le métier de secrétaire. Que le gymnase - pour lequel Beatrice eut d'excellentes dispositions - n'était pas fait pour elle puisqu’elle se marierait, ce qui a son avis était encore la meilleure chose qu'une femme pouvait faire. Le secrétariat, qu'elle a exercé peu de temps, l'ennuyait profondément et après d'âpres luttes avec mon père, durant lesquelles je défendis les intérêts de Beatrice avec le soutien discret, mais efficace, de notre maman, Beatrice put finalement entreprendre une formation de Restauratrice d'art.
Cette profession s'apprenait en ce temps-là comme à la période des corporations médiévales : on allait de Maitre en Maitre auprès desquels l'on se perfectionnait. Son « Tour de France » a elle eut pour étapes Berne, Bâle, Stuttgart, Kassel, Vienne, Oaxaca (au Mexique), Rome et Zürich, où elle trouva sa première Place à l'Institut Suisse des Arts. En 1981 elle vint a Berne, au Kunstmuseum, où elle resta jusqu'à aujourd'hui. De par son métier, elle était amenée à accompagner des toiles de Maitre dans le monde entier et bien souvent, ces étapes professionnelles lui permirent d'effectuer un séjour et de visiter un pays. Elle adorait voyager et ses connaissances linguistiques la servaient partout. Elle s'exprimait et aimait lire en français, allemand, anglais, espagnol et italien, langue qu’elle parlait d'ailleurs très couramment.
Nous étions proches. Et ces dernières années encore davantage, notamment depuis que mon épouse ne pouvait plus se mouvoir aisément et que sa mémoire se faisait plus difficile. Nous avons alors fait de nombreux voyages : Venise, la Bourgogne, la Sicile et toujours et encore Paris, que nous aimions spécialement tous les deux.
Ces derniers mois, je l'accompagnai de façon intense. C'était a nouveau ma petite sœur, et le jour òu elle nous a quittés, ce 2 janvier dernier, j'étais a côté de son lit, m'appuyant sur le rebord de cette nouvelle corbeille, tenant sa main dans ma main. Elle m'regarda fixement de ses yeux bruns et s'en est allée vers de nouveaux pâturages célestes. Il était 18h05.
Würdigung durch Nathalie Bäschlin, Kunstmuseum Bern :
Lieber Walo und Familie, liebe Freunde von Béatrice
Vor langer Zeit, vor rund 18 Jahren, sind Béatrice und ich gemeinsam nach Kitakushu, Japan gereist, um vor Ort eine Sammlungsausstellung des Kunstmuseums Bern konservatorisch zu betreuen. Béatrice, als verantwortliche Restauratorin, ich als Assistentin, die in die Praxis der Ausstellungsbetreuung eingeführt wurde. Beatrice’s Reisefreude, ihre grosse Berufserfahrung und ihr gewandter Umgang in dieser fremden Kultur haben mich sehr beeindruckt. Höflich, aber beharrlich hat sie nicht aufgegeben, bis alle Bedingungen zum Schutz der Gemälde erfüllt waren. Nur einmal auf dieser Reise konnte sich auch Béatrice nicht durchsetzen. Unsere japanischen Gastgeber hatten für uns ein Sight Seeing auf Kiushu eingeplant. Die Fahrt zu den wichtigen Natur- und Kunstdenkmälern der Insel dauerte gefühlte fünf Stunden und sie hatte einen Haken: Wir hatten lange gearbeitet und es war leider bereits dunkel. Wir konnten überhaupt nichts erkennen, ausser hie und da eine beleuchtete Touristeninformation, japanisch geschrieben. Alle höflichen bis eindringlichen Bitten von Beatrice, die Fahrt wegen der Dunkelheit abzukürzen, waren vergeblich. Es gab kein Pardon. Schliesslich blieb uns nur noch die süsse Rache. Zu einer Nachtwanderung im Regen wollten wir die Truppe verdonnern, würden sie es je wagen, nach Bern zu kommen. Oder noch besser zu einer Autofahrt durch das grosse Moos im Dunkeln und wenn möglich mit endlosen Erläuterungen zur Schweizer Landwirtschaft. Wir haben uns die Ausflüge in allen Details ausgemalt und wir haben uns gekugelt vor Lachen auf dem Rücksitz. Unsere liebenswerten und nachsichtigen Gastgeber haben den Zwischenfall wohl als kulturell kurios taxiert, das Programm aber unbeirrt fortgesetzt...als nächster Punkt folgte dann Kugelfisch essen, was uns nicht minder exotisch, aber deutlich attraktiver schien. All die Jahre unserer engen Zusammenarbeit mussten wir immer wieder über dieses absurde Sight seeing lachen und wenn uns jemand geärgert hat, haben wir sie oder ihn kurzum als Kandidatin für die geplante Nachtfahrt durchs grosse Moos vorgemerkt.
Der herzhafte, zuweilen schwarze Humor, den ich auf der besagten Reise zum ersten Mal in voller Blüte erlebt habe, hat uns immer wieder von neuem zusammengeschweisst, fachliche Diskussionen in schallendem Gelächter enden lassen und uns immer wieder darin bestärkt, für die uns anvertraute Aufgabe – die Erhaltung des Sammlungsgutes des Kunstmuseums Bern – mit vereinten Kräften einzustehen. Nicht nur das Lachen, sondern auch die aufrichtige Fürsorge, ihr offenes Ohr für Bedrückendes und ihr unerbittlicher Kampfgeist, der sofort aufkam, wenn sie Ungerechtes gewittert hat, haben Vertrauen geschaffen. Das Vertrauen auch dafür, dass ich nicht gekränkt sein durfte, wenn ich auch nach vielen, vielen Jahren immer noch mehrmals nachfragen musste, um zu erfahren, wohin und mit wem sie in die Ferien fuhr. Béatrice hat Vertrauen geschaffen durch Zuhören, das Erzählen von persönlichen Dingen hat sie lieber andern überlassen.
Die Mitarbeitenden des Kunstmuseums Bern haben mir in den letzten Tagen zahlreiche Erinnerungen an Béatrice zukommen lassen, die ich hier gerne einbinden möchte. Wie ein roter Faden ziehen sich der erfrischende Humor und die Ernsthaftigkeit und Genauigkeit in der Sache durch alle Schilderungen:
Für Béatrice war klar: Die Gemälde und Skulpturen sind für die Ewigkeit, wir hingegen haben in unserem kurzen Dasein die Aufgabe, sie zu pflegen und zu schützen, selbst wenn es darum geht, sie gegen das Tagesgeschäft museumspolitischer Interessen zu verteidigen und dabei Konflikte nicht zu scheuen. Béatrice war beharrlich und kämpfte, für sie gab es in dieser Sache keine halbseidenen Kompromisse. Ihre Verantwortung für die Kunstwerke hat sie ethisch begründet. Ihre Tätigkeit war für sie deshalb weit mehr als nur Beruf, sie war Teil ihres Lebensentwurfs. Ihre engagierte und kompetente Art konnte auf den ersten Blick einen strengen, manchmal einschüchternden Eindruck hinterlassen. Legendär sind Béatrice’s eiserne Vorgaben zur Schädlingsprävention. Ihr Argusauge über das Gemäldedepot des Kunstmuseums hat sich sogar bis in die Träume ihrer Kollegen eingeschlichen. Die Registrarin träumte einmal von einem kleinen Elefanten, der sich in den Vorraum des Gemäldedepots verirrt hatte und den sie hinter Wellkartons und anderem Verpackungsmaterial versteckte und fütterte. Ein unhaltbarer Zustand, denn sie wusste, dass Béatrice niemals ein Tier in der Nähe der Gemälde dulden würde – und prompt kam sie ihr auf dem langen Gang aus ihrem Büro entgegen und schaute sie misstrauisch an. Über die Erzählung des Traums musste Béatrice herzhaft lachen. Man konnte mit ihr auch über Dinge lachen, die einen aufgeregt oder gewundert, gestresst oder irritiert haben. Sie hat so viele schwierige Situationen entschärft. Man konnte auf Kurierreisen mit ihr um die Häuser ziehen, mit ihr Wodka an der Eisbar schlürfen. Béatrice war eine Frau mit Rückgrat. Ihr markantes Lachen, ihre Zuverlässigkeit und ihr grosses Herz werden uns sehr fehlen.
Das Schlusswort gebührt unserem französischsprachigen Kollegen: La langue française nous a particulièrement rapprochée, ce qui nous a souvent donné l’occasion d’engager de longues discussions interéssantes, dans lesquelles son impulsivité enthousiasmante me restera toujours en mémoire. Bon voyage Béatrice.
Doris Ilg-Hunter (1939 bis 1916), meine Gattin
Doris Ilg- Hunter verstarb am 25. Januar 2016 nach Jahren der Demenz. Ich liebte sie sehr, sie fehlt mir.
Ich beschreibe sie mit der Todesanzeige und den Abschiedsworten an ihrer Abdankung
Brief an den Himmel von Walo C. Ilg, zuhanden von Doris Ilg, vorgetragen von Rosemarie Grütter
Mein liebes Dorli,
du weilest jetzt in anderen Gefilden und bist von irdischer Last und Schmerz erlöst. Darüber bin ich einerseits erleichtert, denn es war in den letzten Tagen deines irdischen Seins nicht mehr zu ertragen und anzusehen, andrerseits fehlst du mir schmerzlich.
In dieser Abschiedsstimmung drängt es mich, Rückschau auf unseren gemeinsamen Lebensweg zu halten, der im Jahre 1975 an einem Kurs der von Vollmar-Akademie in Rotschuo am Vierwaldstättersee begann. Da fielst du mir auf: Engagiert, kämpferisch und von einem fühlbar grossen Herzen beseelt, darüber ein nicht zu übersehender und verlockender Busen, der viel versprach und mich sehr faszinierte.
Du warst damals in Zürich und in Scheidung von deinem ersten Ehemann; ich war Assistent an der dortigen Universität. Immer öfter hatte mein Aufenthalt in Zürich nicht bloss akademische Bedeutung, sondern galt dir. Da lernte ich auch deine Kinder kennen, die für mich vom ersten Augenblick an auch meine waren.
Schon in dieser ersten Phase waren die Gemeinsamkeiten stark und klar: Engagierte Diskussionen – mit dir war es nie langweilig -, gutes Essen und politische, kulturelle und historisch geteilte Interessen und vor allem ein intensives Liebesleben mit einer grossen gegenseitigen Zärtlichkeit. Diese Konstanten blieben uns in guten und schwierigsten Zeiten – wenngleich in unterschiedlichem Masse – erhalten.
Von Anfang an auch eine andere Konstante: Meine Familie war der Beziehung mit dir gegenüber reserviert. Meine Mutter - sonst eine sehr liberale und emphatische Frau – meinte: „Elle a vécu“ – sie hat gelebt. Dieses Spannungsfeld machte mir viel zu schaffen und im Laufe der Jahre stellte sich ein modus vivendi ein, später ein ganz leidlicher Frieden.
Wir heirateten trotzdem am 07.09.1979 in Aeschi über dem Thunersee, nachdem wir eine halbe Stunde das Standesamt gesucht hatten. Wie haben wir darüber gelacht!
Wir führten eine sehr lebendige Ehe mit grossartigen Höhepunkten, wo du deine Organisations- und Verhandlungskunst entfaltet hast, in wunderschönen Ferienreisen beispielsweise, wo du beste Hotels zum besten Preis buchtest. Wir entdeckten miteinander vorwiegend Europa und waren durch die Vielfalt und den kulturellen Reichtum dieses Erdteils fasziniert. Das sind frohe Erinnerungen. Du warst auch immer darauf bedacht, mich zu umsorgen, damit es mir gut gehe. Einziger Nachteil deiner Bemühungen, es war teuer. Hier liess ich dich – meinem eher grosszügigen Naturell folgend – vielleicht zu sehr gewähren. Aber du hast es schliesslich gemerkt und thematisiert. Da war es für mich abgetan.
Du hattest Kanten und Ecken, konntest sehr fordernd und stur sein, auch warst du eine Meisterin in der Nutzung weiblicher Waffen. Ich lernte rasch und blieb dir wohl nur wenig schuldig. Da knallte es mitunter ganz schön, aber die Versöhnung im Schmollzimmer unter der Bettdecke war umso himmlischer.
Vorzüglich verstanden wir uns betreffend der Kinder. Wenn du oder ich einen Entscheid getroffen hatten, wenn wir uns nicht absprechen konnten, so haben wir uns vorbehaltlos gedeckt. Wir haben uns auch in allen wichtigen Erziehungsfragen verständigt. Das war sehr gut und hat uns trotzdem gefordert. Dass die Erziehung von zwei Kindern eine grosse Herausforderung ist, war mir sofort klar. Nicht dass Monika und Robi schwierige Kinder gewesen wären, aber sie forderten Engagement und Zuwendung.
Du wolltest unbedingt ein Kind von mir. Ich wollte nicht und sagte dir: „Wir haben zwei, das reicht“. Auch warst du nicht die geborene Mutter. Ich war wohl den Kindern gegenüber mehr mütterlich als du. Dafür warst du konsequent und das war sehr gut. Mitunter warst du auch hart, da habe ich etwa die Kanten geschliffen.
Eines hast du immer klar den Kindern mitgeteilt: Du seiest deren Mutter und als solche setztest du dich vorbehaltlos für sie ein. Aber du seiest auch Frau und als solche gehe die Beziehung mit mir allem anderen vor.
So spielte sich eine Ehe und ein Familienleben ein – wie in allen einigermassen guten Ehen -, das ein komplexes Gleichgewicht des Schreckens war, aber auch und vor allem geprägt von Zärtlichkeit und Humor, was manche Spitze brach. Gerne erinnere ich mich an den Frühstückstisch am Wochenende, wo es lustig, herzlich und heiter zuging. Ich war gerne dein Ehemann und der Vater deiner Kinder.
Beim Räumen deines Zimmers bin ich in den letzten Tagen auf deine Manuskripte gestossen und habe darin geblättert. Da habe ich dich voll und ganz wiederentdeckt: Die engagierte Doris, die Sendungen am Radio über die Emanzipation der Frau machte, einem Pateipräsidenten schriftlich die Leviten lies, Aufzeichnungen für deine Kurse als Erwachsenenbildnerin, die du warst. Da entdeckte ich auch eine Notiz von dir mit einem Hinweis auf eine Rechnung des Modehauses „Messerli“. Ich erinnerte mich: Ich hatte ein Mandat kosovarischer Kriegsflüchtlinge, die in der Schweiz gestandet waren. Sie hatten eine halbwüchsige Tochter, ein an sich hübsches, etwas molliges, Mädchen, aber so unvorteilhaft gekleidet, dass sie die Zielscheibe des Spottes ihrer Mitschüler war. Du gingst mit ihr kurzerhand zum „Messerli“ und kleidetest sie neu ein. Das Mädchen war wie verwandelt. Das warst du pur. Da hast du aus dem Herzensimpuls heraus gehandelt, aber auch politisch bewusst, überzeugt und entschieden.
Hier kann ich nur wiederholen, was deine Schwägerin Paulette mir am 18. Janaur schrieb: Ç'est une femme formidable que j'ai toujours admirée – Es ist ein fantastische Frau, die ich immer bewundert habe.
Ab der Jahrtausendwende ist mir aufgefallen, dass du dich verändert hast. Du wurdest in einigen Dingen etwas wunderlich. Aber ich schrieb das deiner Originalität zu, welche sich mit dem Alter wohl akzentuiere. Eine medizinische Untersuchung zeigte dann, dass deine geistigen Kapazitäten minderten. Du lebtest in Münsingen in einer betreuten Alterssiedlung und ich nach meinem schlimmen Unfall in Bern. Das waren trotz deiner wachsenden Einschränkungen gute Jahre. Wir telefonierten uns täglich, verbrachten die Wochenenden zusammen und erfreuten uns an der Zweisamkeit, unbelastet durch die subtilen Ärgernisse des täglichen Zusammenlebens. Den Sommer genossen wir besonders. Ich kam gegen Mittag und wir gingen zusammen in die „Badi“, schwammen, assen dann gemeinsam und freuten uns miteinander. Am Wochenende speisten wir oft auf deiner Terrasse, mit Blick auf die imposanten Berner Alpen.
Du hast sukzessive deine Kanten und Schärfen verloren und deine eigentliche Stärke blühte auf: Dein Herz. Du sahst die Welt, wie der kleine Prinz von Saint-Exupéry, nur noch mit dem Herzen gut.
Im Jahre 2011 hast du einen Gehirnschlag erlitten und nach der Rekonvaleszenz war klar, dass du nicht mehr alleine wohnen könntest und wir platzierten dich nach gemeinsamen Erwägungen im Fischermätteli, wo du zuerst auf der normalen Abteilung warst. Dort hast du dich recht gut eingelebt. Wir sahen uns täglich und machten am Wochenende Ausflüge. Das sind sehr gute Erinnerungen.
2013 im Juni sind wir dann zusammen für fast einen Monat nach Frankreich in die Ferien ins Chateau de Gorce gereist, wo eine Autorin meines Verlages wohnt. Da haben wir eine wunderschöne Zeit verlebt, auch dank der Unterstützung unserer Gastgeber. Wir waren zusammen und du hast es sichtlich genossen. Ich auch, wiewohl mir unerbittlich klar wurde, dass deine Fähigkeiten rapide abnahmen.
Wieder zurück im Fischermätteli wurde augenscheinlich, dass du nicht mehr in der Normalabteilung leben könnest und wir versetzten dich ins Mosaik, der Abteilung für Demente. Du hast dich dort gut eingelebt und es waren noch schöne Jahre mit dir. Ich kam jeweils im Laufe des Nachmittages, oft zusammen mit Monika, und wir haben viel gelacht. Ich machte kleine Spässe, die dich immer gefreut haben. Gestrahlt hast du, wenn ich um die Ecke kam und du mich sahst. Deine Ängste wichen und du wurdest viel entspannter.
An Wochenenden fuhren wir noch zusammen aus und freuten uns gemeinsam an Zvieris und schönen Landschaften. Du warst zufrieden.
Am Freitag, den 15. Januar, hast du eine kleine Lungenembolie erlitten. Am Samstag schien es dir besser zu gehen. Am Sonntag zeigte sich, dass es dem Ende zugehe. Ich habe dich in der letzten Woche dieses hiesigen Daseins intensiv begleitet und versuchte, was ich konnte, um dein Leiden zu lindern, wie du wohl noch gemerkt hast. Eine deiner letzten Bemerkungen mir gegenüber war: „I ha di gärn!“. Ich antwortete dir: „Ig di o“! und wir küssten uns. Dann hast du dich zusehend von dieser Welt entfernt. In meinem Herzen bleibst du aber da und wirst darin leben, bis es zu schlagen aufhört.
Und – wie du sicher von hoher Warte mitbekommen hast - überwältigend viele deiner Mitmenschen haben Mitgefühl für dein Schicksal bekundet und tragen dich in guter Erinnerung.
Nun, mein liebes Dorli, sei schön brav in deiner neuen Heimat, damit dir nicht wiederfährt, was du uns allen immer wieder lachend rezitiert hast:
Dorothé vo Ninifé,
mit de lange Füesse,
sibe Jahr im Himmel gsih,
wider abe müesse.
Aengeli gneckt,
Petrus Zunge use gstreckt!
Het dr Petrus gseit:
„Dorthe vo Ninifé,
wot die nüm im Himmel gseh!“
Liebes Dorli, ich küsse dich
Dein Walo